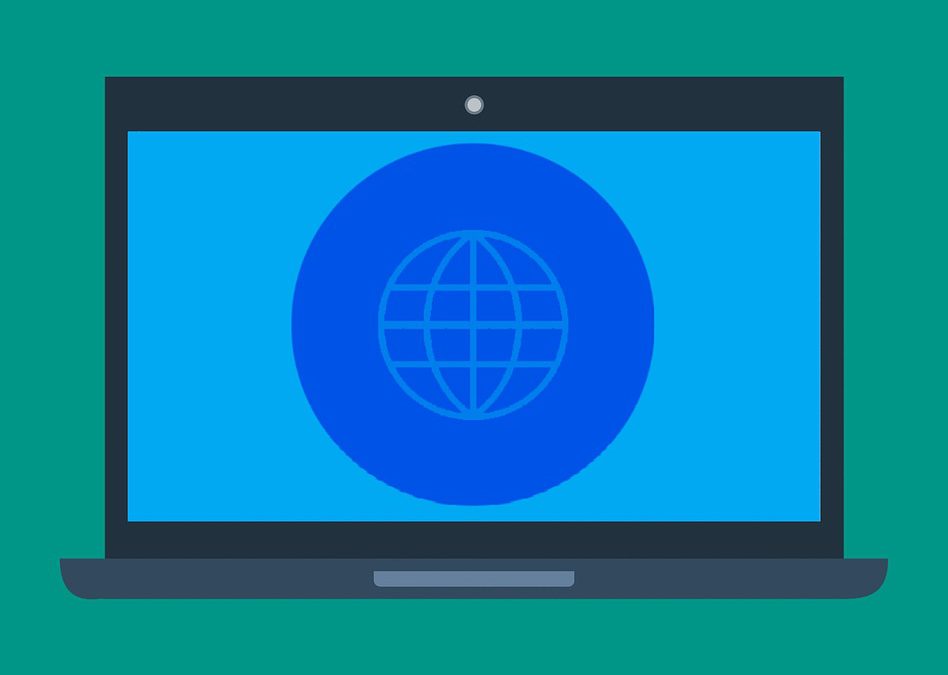Mit der Durchdringung unserer Gesellschaft durch das World Wide Web erleben wir gerade eine Kommunikationsrevolution, wie es sie seit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg vor über 500 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und wir sind noch mittendrin in dem Prozess. Aber was macht diese Revolution eigentlich aus? Und wie revolutionieren diese Veränderungen unseren Alltag? Hier stelle ich sechs wichtige Wirkungsweisen vor:
1. Inhalte in Echtzeit, überall
Wir können überall und jederzeit Inhalte konsumieren und Informationen abrufen. Die Website kann ich auch in der U-Bahn anschauen, eine Radio-Sendung beim Joggen als Podcast anhören. Über Cloud-Services kann ich überall auf meine Dokumente zugreifen. Mit seinem Smartphone oder Tablet-PC trägt jeder seine sozialen Netzwerke wie Facebook mit sich herum; ebenso wie seine Bücher, Notizen und eine Suchmaschine, die ihm alle Inhalte des Internets erschließen kann. In Zukunft kann uns Augmented Reality in Verbindung mit dem Internet der Dinge ermöglichen, dass wir zu allen physischen Dingen, die wir in der Welt sehen, Metainformationen angezeigt bekommen.
2. Jeder kann Informationen verbreiten
Früher sendeten Medien wie die Zeitung und das Fernsehen einseitig Botschaften zu ihren Konsumenten – den Lesern oder Zuschauern. Die Barrieren, um selbst Inhalte zu verbreiten waren oft hoch, Redakteure und Verleger bestimmten was öffentlich wird. Heute kann jeder Inhalte ins Netz stellen. Suchmaschinen und soziale Medien ermöglichen es, mit einem Thema weltweit große Gruppen von Menschen zu erreichen. Die technischen Mittel dazu werden immer billiger, leistungsfähiger und benutzerfreundlicher: zum Beispiel Videodreh und -schnitt, Webhosting und Fotografie.
3. Nutzer kommen über andere Wege an Informationen
Gingen wir früher um etwas herauszufinden in die Bücherei, blätterten im Telefonbuch und informierten uns über Neuigkeiten in der abonnierten Zeitung unserer Wahl, so suchen wir heute Antworten auf unsere Fragen bei Suchmaschinen (Pull-Prinzip) und werden über soziale Medien in Echtzeit mit neuen Nachrichten gefüttert (Pull-Prinzip). Welche Informationen uns medial erreichen entscheiden jetzt nicht mehr nur Redakteure und Verleger. Eine wichtige Rolle spielen immer mehr Menschen aus unserem persönlichen Umfeld, die uns Inhalte in sozialen Medien empfehlen und selbst Inhalte erstellen. Aber immer wichtiger werden auch Algorithmen, die jeden Einzelnen von uns in einer „Filterblase“ aus Informationen leben lassen, die durch ein intransparentes und komplexes System automatisch erzeugt werden.
4. Informationen können auf neue Weise geordnet werden
Früher waren Informationen an stoffliche Datenträger gebunden wie Bücher und Dokumente aus Papier. Diese Medien musste man in einer physischen Ordnung in Räumen lagern wie in Bibliotheken, Archiven und Registern. Die erste Welle der Digitalisierung sorgte dafür, dass man Informationen jetzt auf physischen Datenträgern durchsuchbar machen konnte, sie teilen und zusammenführen konnte. Im riesigen Pool des World Wide Web schweben die Informationen heute „frei im Raum“. Die Nutzer können dezentral Verknüpfungen zwischen den Informationen herstellen über Hyperlinks und Verschlagwortung. Man kann Suchanfragen stellen und sich blitzschnell Ergebnis-Berichte zusammenstellen lassen. Der Wissensmanagement-Experte David Weinberger nennt das die „3. Ordnung“ von Informationen, im Gegensatz zur ersten Ordnung (Anordnung stofflicher Informationsträger im Raum) und der zweiten Ordnung (Verzeichnung der Medien in Übersichts-Büchern aus Papier). In Zukunft könnte das Web zu einer uns überall umgebenden künstlichen Intelligenz werden, in der uns Assistenten bei allen möglichen Aufgaben unterstützen und kognitiv entlasten. Die großen Tech-Firmen wie Google und Facebook arbeiten gerade mit Hochdruck an dieser Transformation.
5. Ein Medium vereint alle bisherigen in sich
Bewegtbild, Ton, Texte, interaktive Anwendungen – all das wird jetzt eines, und zwar in Echtzeit. Mit dem Einzug von 3D-Technologie in Form von 3D-Video, Augmented und Virtual Reality und der Verschmelzung von Webseiten und Apps werden in Zukunft noch ganz neue mediale Formate möglich sein. Immer mehr Bildschirme werden uns an jedem Ort diese Inhalte unkompliziert zugänglich machen, und Wearables können sie wie ein Filter über die Sinne legen, mit denen wir unsere Umgebung wahrnehmen.
6. Interessengemeinschaften und Nischenmärkte vernetzen sich
Ob in Foren, sozialen Netzwerken oder Fachportalen: Es bilden sich weltweite Gemeinschaften von Menschen, die sich für das gleiche Nischenthema interessieren, sogenannte Communities. Das können Angehörige demenzkranker Menschen ebenso sein wie Sammler von Artefakten aus dem Ersten Weltkrieg, oder Anhänger der Ideologie von Leo Trotzki. Der Journalist und Bestseller-Autor Chris Anderson beschreibt dies als den Long-Tail-Effekt: Selbst die exotischsten Nischen können sich im World Wide Web zu Communities und Märkten entwickeln. Sie können gemeinsam Informationen sammeln, Waren und Dienstleistungen austauschen, über Kontinente hinweg zusammen an Projekten arbeiten… auch große und komplexe Projekte können von diesen Gruppen in weltweiter Zusammenarbeit angegangen werden. Schlagworte sind hier „peer production“ und „crowdsourcing“. Das Buch „Wikinomics: How mass collaboration changes everything“ von Don Tapscott und Anthony D. Williams, 2007 erschienen, aber immer noch aktuell, ist voll solcher positiver Beispiele.